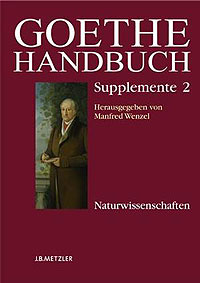 |
„Für freundliche Teilnahme dankbar. Fortgesetzte Geduld wünschend. Ferneres Vertrauen hoffend“
Goethe-Handbuch, Supplemente 2: Naturwissenschaften |
Kein Zufall ist es, sondern fügt sich glänzend, dass drei der vier voluminösen Bände der „Bibliothek Deutscher Klassiker“, die Goethes naturwissenschaftlichen Schriften gewidmet sind, von Manfred Wenzel herausgegeben wurden – er hat nun auch den zweiten Supplementband des Goethe-Handbuchs verantwortet, der den Naturwissenschaften gewidmet ist. Und wer es vorher nicht gewusst hat, wird es auf den 850 Seiten des gewaltigen Werkes gewahr: was für ein in alle Richtungen ausschweifender, gleichzeitig bohrender und sammelnder Geist Goethe gewesen ist. Farbenlehre, Physik, Witterungslehre, Geologie, Optik, Morphologie – was immer seine Sinne zu erregen, seinen Geist zu fesseln vermochte, das hat er in jeglicher Form beschrieben. Von der Tagebuchnotiz über den Brief, vom Aufsatz und Essay bis zum groß angelegten Prosawerk. Daneben und dazwischen Gedichte, die sinnlich erfassten, was der Dichter zu anderen Zeiten, in anderen Formen abstrakt und rational darstellte.
Zum Goethe-Handbuch also nun den dritten und abschließenden Supplementband. Der Duden definiert das Wort mit „Ergänzungsband“, und man kann nur staunen, was alles es zum Hauptwerk noch zu ergänzen gab: 2008 „Musik und Tanz in den Bühnenwerken“, 2011 „Kunst“ und 2012 nun der stärkste Band: „Naturwissenschaften“. Fast sein gesamtes Leben hat sich Goethe hier mit allen nur denkbaren Bereichen befasst. Hat 1784 in der vergleichenden Anatomie den menschlichen Zwischenkieferknochen entdeckt (was heruntergeredet wurde, indem man auf einen französischen Arzt hinwies der ihn schon 1780 entdeckt habe). Sein umfangreichstes Werk überhaupt, die 1810 erschienene „Farbenlehre“, die er als sein Vermächtnis an die Nachwelt verstand, wurde mit so viel Häme überschüttet, dass ein schwächerer Charakter als er verstummt wäre.
Goethe schrieb weiter, und es kamen noch eine ganze Reihe von Schriften, die Manfred Wenzel als „Farbenlehre nach 1810“ zusammenstellte. Mit Fug und Recht können noch Goethes letzte Briefe an Boisserée unter der Überschrift „Verhandlungen mit Herrn Boisserée den Regenbogen betreffend“ hier eingereiht werden. Und noch einmal zielt er wie stets von Besonderen ins Allgemeine. „Ich habe immer gesucht das möglichst Erkennbare, Wißbare, Anwendbare zu ergreifen“, schließt er, „und habe es, zu eigener Zufriedenheit, ja auch zu Billigung anderer, darin weit gebracht.“ Und setzt die hoffende Schlussformel dahinter: „Für freundliche Teilnahme dankbar, Fortgesetzte Geduld wünschend, Ferneres Vertrauen hoffend.“
Da war nun viel zu hoffen und bei Boisserée sicher nicht vergebens, aber oft hatten die Leser von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften eben nicht die fortgesetzte Geduld, sodass er, was nach der „Farbenlehre“ kam, eher in Zeitschriften versteckte als in Büchern präsentierte. Immer wieder lässt sich aus den „Supplementen“ herauslesen, dass Goethe als Dichter geliebt, später geduldet wurde, aber als Forscher mit allen Mitteln des Hohns gerade mal hingenommen wurde. In der „Farbenlehre nach 1810“ stehen Verse, die wie Bitten um Verständnis und gleichzeitig wie ein Zurechtrücken der wirklichen Verhältnisse anmuten:
Bringst du die Natur heran
Daß sie jeder nutzen kann;
Falsches hast du nicht ersonnen,
Hast der Menschen Gunst gewonnen.
Der Supplementband ist entmutigend dick, dann aber doch wieder so klug gegliedert, dass man sich relativ leicht hindurch findet. Der erste Teil bringt Übersichtsartikel (die übrigens in etwa der Gliederung der Frankfurter Ausgabe folgen), und schließt mit einer Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis zur Gegenwart. Der zweite Teil bietet ein Personen- Orts- und Sachlexikon (dass wiederum deutlich mit dem Hauptwerk des Handbuchs verknüpft ist).
Wenzel kommt es sehr darauf an, Goethe als Naturwissenschaftler ebenso sehr wie als Schriftsteller verstanden zu wissen. Schon im Vorwort präpariert er dessen Verärgerung über eine Bemerkung des französischen Botanikers Augustin Pyrame de Candole heraus, es sei doch seltsam, dass der deutsche Dichter in seiner Metamorphosenlehre „en passant une découverte importante“ gemacht habe. Also, könnte man übersetzen, eine wichtige Entdeckung mal eben mit links. Goethe ist dem später mit einem eigenen Aufsatz entgegengetreten. Vergeblich, wie wir gesehen haben. Dabei hat sich Wilhelm von Humboldt schon 1830 „eine erstaunliche Parallelität zwischen Goethes Erkenntnisprozess im Aufspüren der Gesetze der Natur und seinem Vorgehen in der dichterischen Produktion“ offenbart (Wenzel).
Mit anderen Worten: Man vergaß, dass die Wissenschaft sich einst aus der Poesie entwickelt hat. Oder: Wir können den Dichter nicht ohne den Forscher haben. Oder: Natur und Dichtung sind bei Goethe zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wenzel hat beide Seiten im Blick, wenn er betont: „Trotz der reichhaltigen Informationen, die der vorliegende Band zu bieten hofft, sollte der Leser nicht auf die Lektüre der Originaltexte verzichten. Auch Goethes naturwissenschaftliche Schriften sind sprachliche Kunstwerke und bieten wunderschöne Leseerlebnisse.“
Goethe-Handbuch. Supplemente 2: Naturwissenschaften. Hrsg. von Manfred Wenzel. Stuttgart: J. B. Metzler 2012. XXXVII, 6851 S. Geb. 99,95 €